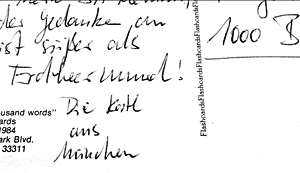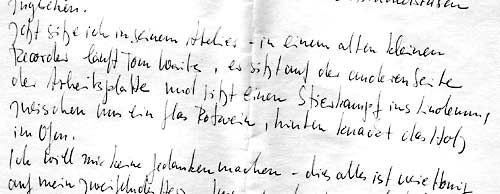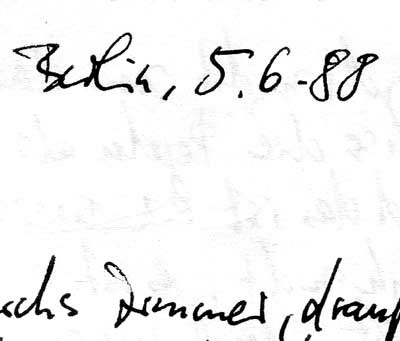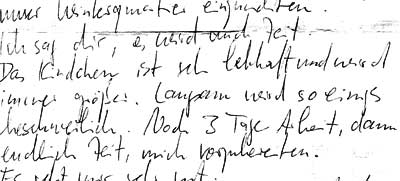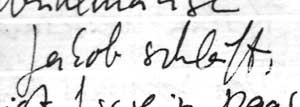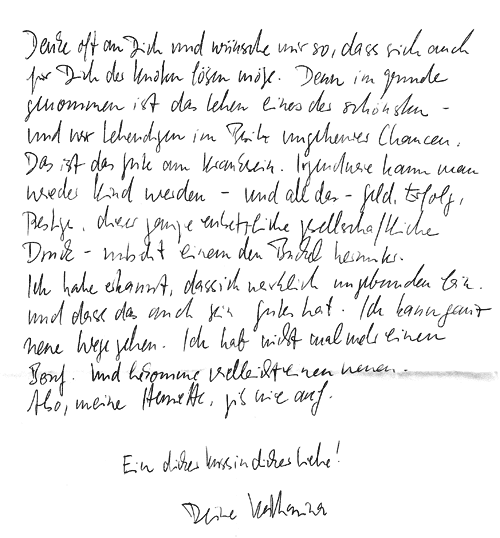| Geändert am 24.7.2012 | ||
Henriette Kaiser |
Filme | Bücher | Aktivitäten |
3 Leseproben aus "Schlussakkord"
|
Bücher > Katja |
|
Postkarte Katja an Henriette 1985
Seite 61-63 die schmerzen 25. Januar 2002. Das Telefon klingelt. Katja – schon in München. Sie erzählt so schnell, dass ich kaum verstehe, was passiert ist: Das linke Bein schwoll an, auf Teneriffa konnte niemand sagen, warum. Deshalb gestern die überstürzte Rückkehr. Die hiesigen Ärzte diagnostizierten sofort eine Thrombose und gratulierten, dass sie den Flug überlebt hat. Dann stellten sie neue Metastasen fest. Mit dem bloßen Auge. Eine Computertomographie ist für morgen anberaumt. Ob ich heute noch ins Krankenhaus kommen könne? Ich besuche Katja. Ihr Anblick fesselt mich. Sie ist braun gebrannt, erholt, wie man es nur von Meer, Sonne und Wind sein kann. Sie ist noch dünner als bei ihrem Abflug. Die Vierzig-Kilogramm-Grenze hat sie unterschritten. Eine zerbrechliche Anmut, die kaum noch etwas Irdisches hat. Im perversen Gegensatz dazu das geschwollene Thrombosebein, das sich wie der Mount Everest unter dem weiten Nachthemd emporwölbt. Und dieser aufgekratzte Pickel auf ihrem linken Nasenflügel. Die Schmerzen müssen entsetzlich sein. Immer wieder zuckt Katja zusammen. Nicht nur das Thrombosebein schmerzt. Die Morphinpflaster wirken nicht mehr. Ein anderes Mittel kann aus irgendeinem Grund nicht verabreicht werden. Zuerst rege ich mich darüber auf, aber dann werde ich von den Auswirkungen der Schmerzen überwältigt. Innerhalb von zwei Tagen ist Katja blass, ihre Stimme ein Hauch. Kein Medikament kann gegen die Schmerzen aufgetrieben werden. Nur warme Vollbäder bringen ein wenig Entspannung.
Brief Katja an Henriette 1986
Das trostlose Ende des Teneriffa-Aufenthalts, die eindeutige Verschlechterung auf allen Ebenen sind Schock und Läuterung zugleich: Es ist vorbei. Die bleierne Schwere, von der ich mich erholt glaubte, umhüllt mich auf der Stelle wieder. In dieser Dunstglocke gibt es keinen Abzug. Nur einen einzigen. Ihr Tod. Eine Fachfrau für Thrombosestrümpfe kommt. Katjas Bein ist für ihre Strümpfe viel zu lang und viel zu dünn unterhalb des geschwollenen Oberschenkels. Weder in der verlockenden Farbe »Haut« noch in Weiß oder Schwarz kann sie fündig werden. Für Katja muss ein Strumpf genäht werden. Wir einigen uns auf »frisches Weiß«. Kopfschüttelnd misst die Fachfrau das Bein mehrmals nach. Katja und ich unterdrücken ein Kichern. Sonst gibt es nicht viel zu kichern, wenn wir uns zwischen den Schmerzschüben im Flüsterton unterhalten. Die verzweifelte Sinnfrage keimt wieder auf. Warum sie, warum nicht ich? Immer sei sie bereit gewesen, in allem einen Sinn zu erkennen, auch wenn sie darunter gelitten habe. Aber jetzt fühle sie sich außerstande, einen Sinn zu sehen. Die Antwort dröhnt in meinem Kopf, aber ich schweige. Ich kann nicht von purer Sinnlosigkeit, dem reinen Zufall reden. Gleiches gilt für alle Formen von selbst auferlegten Martern, mit denen man im gesunden Zustand so nett kokettieren kann. Nicht einmal lakonisches Achselzucken bringe ich zustande. Ich bin gesund. Meine Freundin muss sterben. Ich seufze und greife ihre Hand. Sie schließt die Augen, wir schweigen. Szenen, die ich in Indien erlebt habe, tauchen vor mir auf. Neben der Leichenverbrennung spielen Kinder, Kühe latschen herum. Uralte Männlein zelebrieren ein schlichtes Waschritual, während ein Esel auf den Treppenstufen zum Fluss stirbt und Teenager Kricket spielen. Die Sinnfrage erübrigt sich da. So ist es, das Leben. Alles findet gleichzeitig statt, alles hat seine Berechtigung, alles gehört dazu. Nichts muss weggeschoben, verdrängt werden. Schon gar nicht der Tod. Warum können wir das in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft nicht so einfach sehen. Warum. Weil bei uns alles Tun, alles Geschehen einer Bewertungsskala von sinnlos bis sinnvoll unterliegt? Weil wir wertlos nennen, was sinnlos wirkt? Weil wir ein Schicksal eher annehmen können, wenn es sinnvoll scheint? Wenn es den selbst gestellten Erwartungen entspricht? Glück, Erfolg, Hab und Gut als Qualitätssiegel für das Leben? Unerreichte Pläne, versäumte Ziele als Fehler? Verdrängen wir den Tod, weil wir ahnen, wie brüchig dieses System werden kann? Übertreibe ich jetzt oder zeigt sich an dem hadernden Kampf meiner Freundin wirklich eine Dimension, eine Eigenart unserer ganzen Gesellschaft? Meine Freundin ist eingeschlafen. Ich ziehe meine Hand zurück. Sie spürt die Absicht und hält sie fest.
|
||
Seite 67-70 die badewanne 1 2. Februar. Katja macht einen »Krankenhausurlaub« bei ihren Eltern. Dort steht inzwischen ein Rollstuhl für sie, mit dem wir einen Ausflug ins »Adria« machen wollen. Endlich, endlich wieder ins »Adria«. Aber das neue Schmerzmittel versagt den Dienst. Katjas Mutter und ich versuchen den Thrombosestrumpf anzulegen. Das ist nicht möglich. Die Näher erkundigten sich immer wieder, ob die Maße stimmen. Die Maße stimmen. Das Bein ist so lang, die Wade ist so dürr. Aber man kann diesen kilometerlangen straffen Schlauch nicht überziehen, wenn jede noch so leichte Berührung die schlimmsten Schmerzen auslöst. Das Bein muss fortan mit elastischen Bändern gewickelt werden. Katja möchte in die Badewanne. »Erschrecke nicht«, sagt sie. »Keine Sorge«, sage ich. Ich sehe auch durch die schlackernde Kleidung, wie dünn sie ist. Da kann der nackte Leib nicht viel Überraschung bieten. Ich helfe ihr hinüber ins Bad, beim Entkleiden. Sie setzt sich auf den Wannenrand, ich hieve die Beine in die Wanne und halte ihren Oberkörper beim Hinabgleiten ins Wasser. Dann sitzt Katja. Ich sehe sie an. – »Ich muss mal aufs Klo.« Ich verriegle die Toilettentür hinter mir. In mir brüllt eine Stimme: Das ist nicht Katjas Körper. Dieser Körper gehört ihr nicht mehr. Er gehört der Krankheit. Er gehört dem Tod. Da sitzt Katjas Tod in der Badewanne. Ich sprenge kaltes Wasser auf mein Gesicht und atme tief durch. Dann gehe ich zurück ins Bad, nehme den Schwamm und streiche über Katjas Rücken. Der Tod pocht unter meinen Fingern. Er lacht. Frisst, schmatzt, räkelt sich. Fleckige Beulen, Fratzen durch die unzähligen Spritzen. Hieronymus Bosch, Alien, Pest, Verwesung … Uns beiden tut die Berührung gut. Katja entspannt sich ein wenig, ich kann den Schrecken erspüren, ertasten. Die Rollstuhlaktion ins »Adria« wollen wir nachholen. Ja, das wollen wir. Ein paar Stunden später, in meiner Wohnung, sehe ich es deutlich vor mir: Ostern. Zu Ostern, Ende März stirbt sie. Spätestens im April. Eine Katja im Mai kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt keine Katja im Mai. Jetzt ist der 2. Februar. Ich bin schockiert. Ich habe doch überhaupt keine Erfahrung mit Menschen in einem derartigen Zustand. Vielleicht kann sie noch zwei Jahre leben, vielleicht nur eine Woche. Ich weiß es nicht. Ich brauche eine fachkundige Aussage, weil ich Angst habe, mit meiner Vision ihren Tod zu beeinflussen. Auch wenn ich nicht wirklich daran glaube, dass Gedanken solch eine Wirkungskraft haben können. Aber wie soll ich Katja fortan begegnen. Ich rufe unseren Ärztefreund an. Er weiß sicher Bescheid, weil seine Freundin im Behandlungsteam von Katja ist. Natürlich zögert er. Kein seriöser Arzt gibt diesbezüglich konkrete Angaben. Das darf er nicht, das kann er nicht. Aber dann nuschelt er rasch, dass Katja den Jahreswechsel nicht erleben wird. Ich bin überrascht, so lange noch. Er widerspricht nicht, als ich ihm meine Eindrücke schildere. Die Bestätigung gibt mir Ruhe, auch wenn ich mit jeder Pore hoffe, dass Katja diesen Mai erlebt, den Mai im nächsten Jahr, in fünf Jahren, in dreißig Jahren.
Katja an Henriette 1991
5. Februar. Lieber T., ob ich mit dem Rauchen aufgehört habe? Ha! Ich qualme, was das Zeug hält. Plane nächsten Gesundheitsstart am Aschermittwoch, da komme ich von der Berlinale zurück, zu der ich am Freitag fliege. Aber ich habe mordsmäßig gut gearbeitet. Es geht also voran, wenn auch immer noch mit genügend Spannungsmomenten. Jetzt zu Katja. Ich sehe sie fast täglich. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich auch dir nur empfehlen, möglichst bald nach München zu kommen. Ich kenne mich mit Krebsendkämpfen nicht aus, aber … Der Tumor ist gewachsen. Sie hat neue Metastasen. Auch in der Leber. Sie verliert sehr viel Blut durch den Urin. Die Niere streikt. Sie ist erbärmlich schwach und dürr. Ich weiß nicht, wie lange ein derart schwacher Körper diese Qualen mitmachen kann. Aber sie hat inzwischen einen Rollstuhl. Das ist schon mal positiv. Da kann man ein bisschen mit ihr rumgurken. Am Wochenende kommt Jakob nach München. So schlimm es um Katja steht, sie wirkt meist sehr gefasst, sehr ruhig. Natürlich hegt sie noch Hoffnung auf ein Wunder, aber sie hat die schwierigste Runde geschafft, die man da schaffen muss. Sie kann sich irgendwie auf das Sterben einstellen. Ich weiß nicht, wie man das kann. Aber das scheint überhaupt das Wichtigste zu sein, das man während so einer Krankheit hinkriegen muss. Freilich hat sie noch schwache Momente. Nur zu verständlich. Wir anderen versuchen, uns darauf einzustellen. Und wir versuchen, ihr alles ein bisschen leichter zu machen. Außerdem muss man sehen, dass man ihr möglichst viele schöne Dinge beschert. Wozu sie Lust hat. Wenn nur die Schmerzen nicht wären. Die sind das Hauptproblem. Es tut mir leid, dass die Nachrichten aus München nicht positiver sind. Aber es hilft ja nichts. Es ist, wie es ist. Alles Liebe und bis hoffentlich bald.
Katja an Henriette 1993
|
||
Seite 82-86 Jetzt, da es Katja besser geht, kann sie wieder mehr Besuch empfangen. Die Freunde kommen in Scharen. Manchmal wird es beinahe ein bisschen viel. Katja selbst sagt, dass sie gerne mehr allein sein würde. Sie wolle schreiben, sich ihre Gedanken machen. Aber dann freut sie sich doch über jeden Anruf und lädt alle zu sich ins Hospiz ein. Katjas Eltern überlegen, wie man freie Zeiten für Katja einrichten könnte. Aber jeder Plan dahingehend scheitert. Telefonische Vereinbarungen funktionieren nicht. Katja bringt sie durcheinander, manche Besucher halten sich nicht an die Bitte um Vorankündigung und jeder, der bei ihr ist, bleibt länger als vorgehabt. Man kommt nicht weg von ihr. »Und wie geht es deinem Bein?« Mein Bein. Sie fragt mich, wie es meinem Bein geht. Mein Bein ist dick, aber verglichen mit ihrem Bein wirklich nicht der Rede wert, abgesehen von allem anderen. Ich wiegle mein Beinproblem herunter. Sie grinst: »Dass deine Solidarität so weit geht, hätte ich nicht gedacht.« Jaja. Da wird man sogar noch veräppelt, wenn man wie verrückt leidet, weil das gelungenste Körperteil, auf das man immer stolz sein konnte, auch nicht mehr vorzeigbar ist. Katja wird streng. Sie möchte kein »letztes Treffen«, keine Versöhnung mit dieser oder jener Person, der das wichtig wäre, wie sie sagt. Sie möchte nicht, dass Freunde kommen und mit ratlosem Gesichtsausdruck vor ihr stehen und eine Segnung oder irgendetwas erhoffen. Voller Zorn schleudert sie Bücher weg, die in eine »falsche« Spiritualität gehen. »Noch lebe ich«, flucht sie über Briefe, die ein Wort beinhalten, das auf ihr Ende hindeutet. Ich kann Katja nachfühlen und stehe dennoch betroffen zwischen den Fronten. Wie alle anderen bin auch ich vollkommen hilflos, was ihr Sterben angeht. Ich habe nur die Möglichkeit, Katja kontinuierlich und nah mitzuerleben und erahne die Stimmungsschwankungen und die verwirrende Komplexität des Sterbens allmählich. So auch, dass die wesentlichen Dinge nicht mit Büchern oder Worten zu fassen sind. Die kann man nur stumm erleben. Das aber geht nicht von außen, von weiter weg. Da ist man auf das angewiesen, was man sich vorstellen kann. Auch die gut gemeinten Hilfsversuche und die Ausdrucksformen des Mitleids, der Trauer können nur der eigenen Perspektive entspringen. Und da entgleisen eben vielleicht ein paar Worte. So sehr ich mich bemühe, Katja milder zu stimmen, ich fürchte, ich versage.
Katja an Henriette 1994
Tagebucheintrag 25. Februar Manchmal habe ich das Gefühl, ausgesaugt zu werden. Katja nimmt sich, was sie braucht. Und wenn sie etwas anderes braucht, als ich ihr geben kann, dann sagt sie: »Du musst nicht kommen.« Das bedeutet für mich: »Ich will nicht, dass du kommst.« Zumindest glaube ich das für Momente. Ich bin dann fassungslos. Aber ich reiße mich zusammen. Eine andere Freundin, die wie ich viel bei ihr ist, steckt in dem gleichen Dilemma. Sie will nicht mehr anrufen, wartet auf ihren Anruf. Komisch, diesen Gedanken habe ich nicht. Ich rufe Katja an. Und siehe, die Aufregung war umsonst. Sie hat etwas durcheinander gebracht, wollte mich nicht belästigen. Ich denke, mein Gott, wie bin ich egoistisch. Wie leicht lasse ich mich verstören. Dabei zeigt Katja mir doch jeden Moment, wie sehr sie sich freut, dass ich da bin. Wie wohl es ihr tut, dass sie bei mir nicht diese Anforderung spürt. Sie spricht von selbst die Probleme an, die sie mit mehreren Leuten hat. Weil sie niemanden zurückruft, weil sie manchmal so barsch ist. die geburt Das Hospiz zeigt seine Auswirkung nicht nur in der Schmerzbehandlung. Niemand spricht noch von Krebs oder Krankheit. Es geht nur um Sterben und Sterbehilfe. Zuerst erschrecke ich darüber. Dann denke ich: eigentlich logisch. Wenn jemand austherapiert ist, wenn nicht am Ausgang zu rütteln ist, dann ist es nur eine Frage, aus welcher Perspektive die Schmerzbehandlung stattfindet. Soll das noch vorhandene Leben erleichtert werden oder das Sterben? Die Behandlung bleibt die gleiche. Sie unterscheidet sich nur in lebensverlängernden Maßnahmen. In Kliniken oftmals eingesetzt, werden sie im Hospiz vermieden, sofern sie nicht dringend nötig sind, das Sterben zu erleichtern. Beschleunigt wird der Tod dadurch nicht. Weder laufen die Schwestern mit Giftspritzen herum noch schlagen sie mit Hämmerchen auf die geschwächten Patienten ein. Die Schwestern, Pfleger und Ärzte gehen einzig mit einer beruhigenden Sicherheit ihrer Arbeit nach und behandeln den Tod als etwas Selbstverständliches. Dadurch gewinnt erstaunlicherweise auch das noch vorhandene Leben seine Würde zurück. Katja, eine Nachteule, schläft oft bis in den späten Vormittag hinein. Sie wird weder für das Frühstück noch das Waschen geweckt. Alles geschieht dann, wenn es Katja passt, und dann ist der zeitliche Aufwand beträchtlich, den sich das Personal nimmt. Öfters erzählt Katja von ausführlichen Gesprächen mit Ärzten, Schwestern, dem Pfarrer, der immer mal wieder ins Zimmer hereinschaut. Bei keiner Lymphdrainage, die ich miterlebe, kommt das Gefühl von Eile auf. Bei den Waschungen sowieso nicht. Katja wäscht sich noch alleine, zuerst im Bad, später im Bett liegend. Das dauert ganz schön lang. Aber niemand drängt. Sie wird anschließend nur sorgsam eingeölt.
Katjas letzter Brief an Henriette, 2. November 2001
Viele der verunsichernden Verhaltensformen werden im Hospiz plötzlich normal. Manchmal schlägt Katja wild die Decke von sich. Die Schwestern sagen schlicht, das würden sie alle tun. Am liebsten würden sie nackt sterben. Sie wollen raus aus dem engen Körper, dem schmalen Bett, dem kleinen Zimmer. Raus an die Luft. Nach einigen dieser nüchternen Bewertungen dessen, was Katja durchmacht, denke ich: wie eine Geburt. Das Sterben ist wie eine Geburt. Auch jede Geburt verläuft individuell, aber sie unterliegt allgemeinen Gesetzmäßigkeiten und Regeln. Alles findet bei Katja individuell statt, alles scheint einem Schema untergeordnet zu sein. Die Geschehnisse sind nicht unvorhersehbar. Sie sind in das Procedere des Sterbens einzugliedern. Für mich ist diese Erkenntnis eine ungeheure Erleichterung. Nichts an Katjas Qualen wird dadurch gemäßigt, aber die Normalität des Ganzen finde ich bestechend. Außerdem ist es eine schöne Vorstellung, dass Katja mit dem Tod eine Geburt bevorsteht. Eine Geburt freilich in etwas vollkommen Unsicheres, Unklares, Geheimnisvolles. Aber so war es bei ihrer Geburt ins irdische Leben auch. So war es bei uns allen. So wird es bei unserem Sterben vermutlich ebenfalls sein. |
||